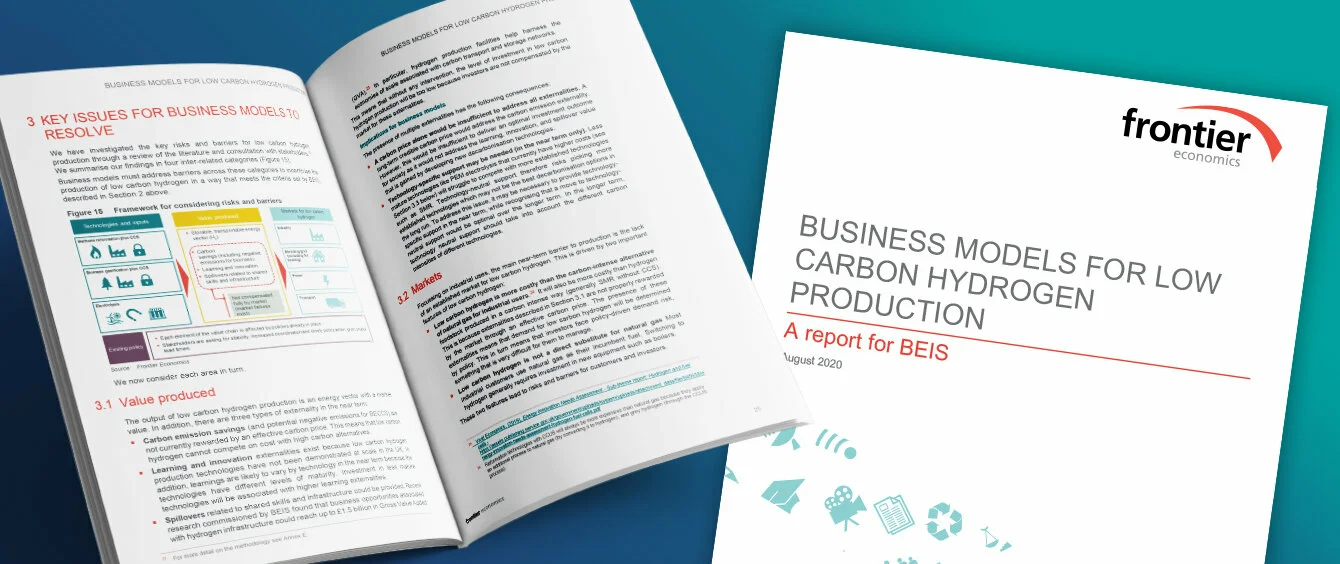Eine „bedeutende CO2-arme Wasserstoff-Wirtschaft“ ist dem nationalen Klimarat Großbritanniens zufolge nötig um die Klimaziele des Landes für das Jahr 2050 zu erreichen: Dann will das Königreich 96 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als im Referenzjahr 1990.
Das Problem: Derzeit existieren im UK keine nennenswerten Kapazitäten zur emissionsfreien Gewinnung des Energieträgers Wasserstoff (H2). Und die Kosten dafür liegen derzeit bis zu viermal höher als für konventionelle Methoden, bei denen Treibhausgasemissionen anfallen.
Kosten dürften deutlich fallen
Doch das dürfte vor allem eine Frage von Skaleneffekten sein: Die erneuerbare Stromerzeugung hat gezeigt, dass Kostenstrukturen vor allem abhängig von der Größenordnung sind: Noch vor 20 Jahren waren Photovoltaik und Windenergieanlagen ein Nischenmarkt. Und die Gestehungskosten für eine Kilowattstunde Wind- oder Solarstrom waren nicht konkurrenzfähig.
Mittlerweile wurden weltweit 586 Gigawatt (GW) Sonnen- und 622 GW Windstromkapazität installiert. Laut International Renewable Energy Agency IRENA beschäftigt die Branche fast fünf Millionen Menschen. Dank des rasanten Wachstums gehören die Technologien heute zu den preiswertesten Möglichkeiten, Stromerzeugungskapazitäten aufzubauen.
Vier Fördermodelle untersucht
Das britische Energieministerium wollte wissen, wie es eine solche Entwicklung auch in der Wasserstoff-Wirtschaft fördern kann? In ihrem Auftrag hat die Beratungsfirma Frontier Economics eine Studie darüber angefertigt, die im August veröffentlicht wurde. Das Ziel: Noch in den 2020er Jahren soll ein kleiner H2-Markt entstehen, der in den 2030er Jahren dank reiferer Technologien heranwächst.
Vier verschiedene Förderansätze haben sich die Analysten genauer angesehen:
Die Regierung zahlt die Differenz zwischen den Produktionskosten konventioneller und nachhaltiger H2-Erzeugung – zum Beispiel im Rahmen von Differenzkontrakten (Contract for Difference, kurz CfD).
Unabhängig von den Produktionskosten wird den Unternehmen ein regulierter Gewinn zugestanden. Die Zahlungen würden ähnlich wie bei den Ausgleichszahlungen ermittelt, wären aber reguliert und nicht vertraglich festgelegt.
Verbraucher werden dazu verpflichtet, eine gewisse Menge H2 zu nutzen, um ihren Energiebedarf zu decken. Die Entwickler würden dann auf die Marktnachfrage reagieren.
Auch auf diese Weise würde eine Nachfrage für CO2-arm erzeugten Wasserstoff gefördert.
Die nachfrageseitigen Anreize haben nach Ansicht der Berater zwei gravierende Nachteile: Zum einen besteht die Gefahr, dass Investoren nicht genug Vertrauen in solche Maßnahmen setzen, weil sie anfälliger für Gesetzesänderungen sind. Zum anderen sind die Kosten für Verbraucher und Steuerzahler theoretisch unbegrenzt. Deshalb empfiehlt Frontier Economics eines der ersten beiden Modelle oder eine Mischung aus beiden.
So könnte es funktionieren
Konkret rät der Report zu einem Ansatz, der auf eine Kostenteilung (split payment) abzielt. Das Ziel: Wasserstoffproduzenten sollen den Anreiz haben, effizient und bedarfsabhängig zu wirtschaften und nur dann Wasserstoff zu erzeugen, wenn er gebraucht wird. Dieses Prinzip hat bereits in der Offshore-Wind-Branche sehr gut funktioniert. Experten erwarten, dass bereits vor Mitte des Jahrzehnts Windparks auf See ohne Subventionen errichtet werden.
In diesem Modell wird im Rahmen eines Differenzkontraktes zwischen Investor und Regierung ein sogenannter Strike-Preis vereinbart: Liegen dann die faktisch erzielten Strompreise des Unternehmens unter diesem Wert, erhält es die Differenz von der Regierung. Liegt der Preis darüber, zahlt das Unternehmen die Differenz in die Staatskasse.
Dies verbindet zwei große Vorteile: Die Unternehmen haben eine hohe Umsatzsicherheit, die ihre Planbarkeit erhöht und dadurch Kapitalkosten senkt, weil Geldgeber eine geringere Risikoprämie auf Kredite erheben. Gleichzeitig gibt es ein Limit für das, was die Steuerzahler aufbringen müssen. Theoretisch haben sie sogar die Chance auf Einnahmen. Um wettbewerbsgerechte Strike-Preise zu erzielen, sollten sie laut Frontier Economics in Auktionen ermittelt werden: Der Bieter mit dem niedrigsten Strike-Preis erhält den Zuschlag. Das setzt Entwickler unter Innovationsdruck und schont die Staatskasse.
Bildnachweis: BEIS